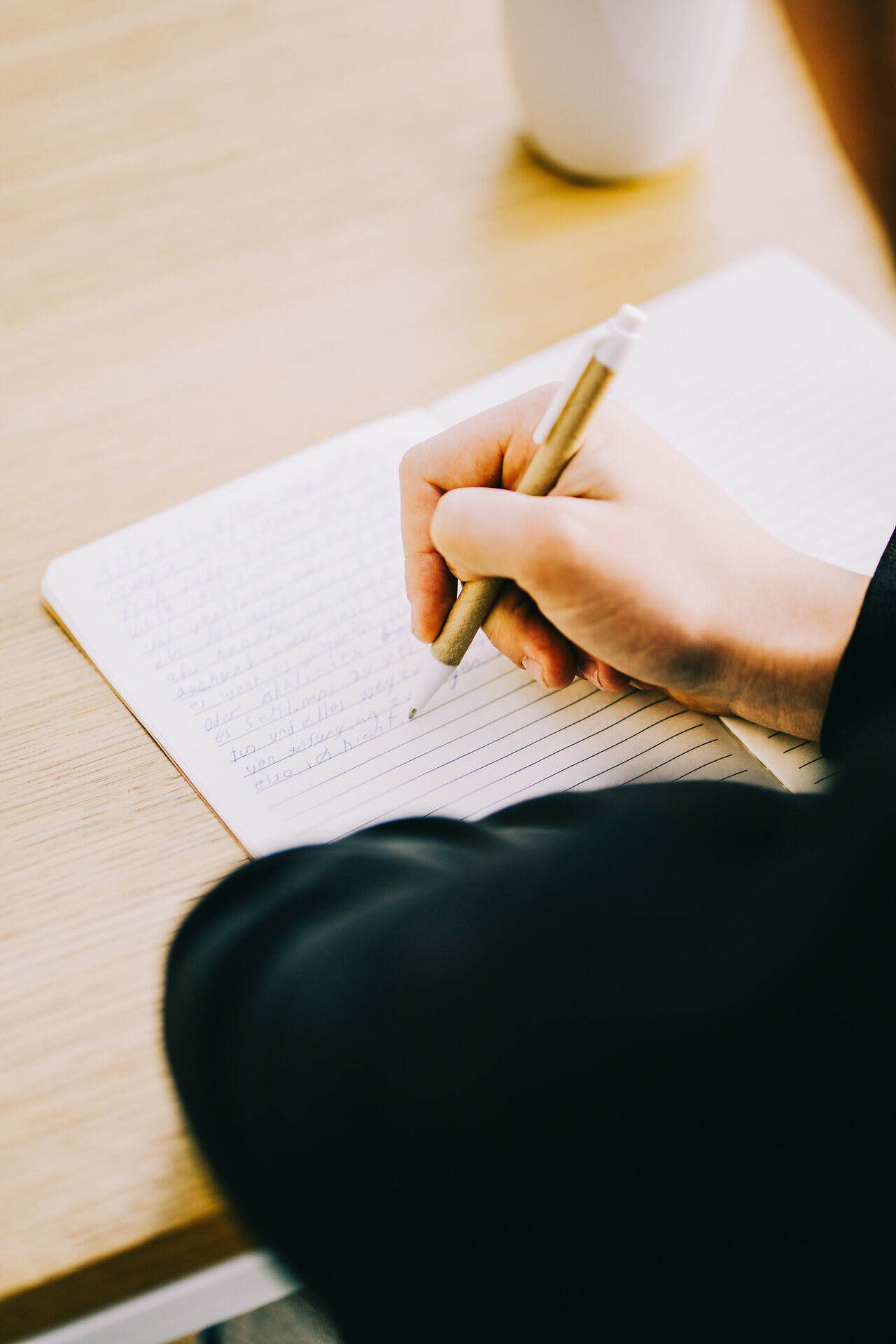Wie waren Sie, Herr Lüdtke, bevor Sie Ihrem Lehrer, Herrn Hanke, begegneten?
Ben Shapiro ist der Posterboy der ultrakonservativen Szene in den USA. Tim Heldt wurde in Deutschland mehrfach wegen Volksverhetzung verurteilt.
Lüdtke: Zu dieser Zeit war diese Art von Content bei meinen Freunden und mir angesagt. Zu Beginn fanden wir das alle ein bisschen cool. Auf einer anderen Schule hatte ich zwei Freunde, mit denen wir uns über Minderheiten lustig gemacht haben oder Memes geteilt haben. Wir wollten edgy sein. Der Unterschied zwischen mir und meinen Freunden war allerdings, dass ich viel mehr Zeit im Netz verbracht habe als sie. Sie haben nicht in dem Ausmaß in dieser YouTube-Welt gesteckt wie ich. Sie sind aus dieser Phase früher herausgewachsen. Dieser Gegenwind, der mir von meinen Freunden entgegenkam, hat mich zu Beginn sogar eher befeuert, meine Positionen in der Klasse zu vertreten. Ich dachte, wenn ich diese unbeliebte Meinung vertrete, dann bin ich mutig, dann traue ich mich was.
Hatten Sie Kontakt zu Rechtsextremen?

Herr Hanke, was war das für eine Zeit, in der Sie Lenny kennenlernten?
Christian Hanke: In der Zeit, in der ich Lenny als Schüler bekam, ist die AfD immer relevanter geworden. Sie schaltete damals die ersten Meldeportale, in denen sie dazu aufforderte, Lehrkräfte zu melden, die ihrer Ansicht nach „linke Ideologie“ verfolgen. Die AfD argumentierte mit einer vermeintlichen Neutralitätspflicht. Ich habe mich infolgedessen intensiv mit dem Beutelsbacher Konsens und dem Berliner Schulgesetz auseinandergesetzt: Was darf ich als Lehrer und was nicht? Ich wollte nicht in Schwierigkeiten kommen und mir sicher sein, in welchem rechtlichen Rahmen ich mich als Lehrer bewegen kann. Ich verstand: Als Lehrkraft ist es meine Pflicht, antidemokratischen Positionen in der Schule entgegenzutreten. Bevor ich Lenny unterrichtete, hatte ich einen Schüler in einer anderen Klasse, der so weit in den Rechtsextremismus abgedriftet war, dass ich keinen Zugang mehr zu ihm bekam.
Wie war der erste gegenseitige Eindruck bei Ihrem Kennenlernen?
Lüdtke: In der allerersten Stunde habe ich gemerkt, dass Christian etwas anders macht als die anderen Lehrerinnen und Lehrer, die mich bis dahin unterrichtet hatten. Christian hat etwa viele verschiedene Sachen ausprobiert, damit die Klasse ruhig wird. Er hat zum Beispiel die Lärm-Ampel eingeführt. Die Farben Grün, Gelb und Rot zeigen an, wie laut es ist. Steigt der Geräuschpegel in der Klasse an, wechseln die Farben. Christian hat wie ein Profi auf mich gewirkt. Das hat mich als Schüler beeindruckt.
Hanke: Wenn ich als Lehrer in eine neue Klasse gehe, fällt ein Schüler oder eine Schülerin nicht unbedingt auf den ersten Blick auf. Aber Lenny tat das. Er hatte auf dem Hals ein großes Tattoo. Ich dachte mir: Was für Eltern erlauben ihrem Kind in der neunten Klasse so etwas? Das hat dafür gesorgt, dass ich ihn sofort wahrgenommen habe.
Lüdtke (lacht): Das war ein Klebetattoo. Es war ein chinesisches Zeichen, von dem ich bis heute nicht weiß, was genau es bedeutet.
Hanke: In den ersten Unterrichtsstunden habe ich ihn als sehr diskussionsfreudig erlebt. Es waren Provokationen dabei, bei denen ich gedacht habe, auf die kann ich mich einlassen, ohne dass diese das demokratische Spektrum verlassen. Ich hatte das Gefühl, dahinter steckt vielleicht ein aufrichtiges Nachfragen.
Lüdtke: Ich habe mich von Beginn an ernst genommen gefühlt. Auch wenn ich viel Quatsch geredet habe – zum Beispiel, dass zwei schwule Männer keine Kinder haben sollten, da das biologisch nicht möglich ist. Bei Christian im Unterricht konnte in den Diskussionen niemand einfach so einen dummen Spruch oder einen unangemessenen Witz in die Klasse rufen. (Er dreht sich zu Hanke) Du hast diese Einwürfe direkt aufgegriffen, immer nachgefragt, bist ihnen nachgegangen.
Hanke: Lenny hat manchmal Kommentare aus der letzten Reihe gemacht, die ich nur halb gehört habe. Das kann ich wirklich nicht leiden. So nach dem Motto: Ich teile das nur mit denen, die eine ähnliche Einstellung haben wie ich. Meine Haltung ist: Wenn du etwas Lustiges zu sagen hast oder eine Diskussion anstoßen möchtest, teile es mit uns allen. Sei aufrichtig, stehe zu deinem Standpunkt und ermögliche uns, ins Gespräch zu kommen.
Lüdtke: Bei Christian hatte ich das Gefühl, dass ich meinen Standpunkt verteidigen muss – eben, weil es um wichtige Themen und Politik geht. Bei vielen Lehrerinnen und Lehrern zuvor habe ich wegen meiner reingerufenen Bemerkungen Ärger bekommen, und dann war es vorbei. Ich hatte das Gefühl, mich einbringen zu können, gesehen zu werden. Ich habe in der Mitarbeit in Deutsch plötzlich gute Noten bekommen. Es hat sich für mich gelohnt, in Diskussionen mit Christian zu gehen. Für mich war bis dahin Deutsch kein gesellschaftspolitisches Fach gewesen.
Was ist Ihre pädagogische oder didaktische Strategie dahinter, Herr Hanke?
Herr Hanke, wie schafft man diesen Balanceakt: einen Schüler wie Lenny ernst nehmen und gleichzeitig die Autorität als Lehrkraft wahren?

Wussten Sie damals, dass Lenny sich im Netz rechtsextremen Content anschaut?
Was hat noch dazu beigetragen, dass Du von rechtsextremem Content abgerückt bist?
Lüdtke: Nicht nur der Kontakt zu Christian allein hat mich beeinflusst. So viel Credit will ich ihm dann auch nicht geben. Ich hatte auch das große Glück, dass meine Freunde mir die Stirn geboten haben. Es war auch die Zeit, in der Fridays for Future groß wurde, mehr People of Color in den Medien auftauchten, die Black-Lives-Matter-Bewegung aufkam. Während meine Freunde sich weiterentwickelten, hatte ich eher das Gefühl, mit meinen Ansichten festgefahren zu sein. Es gab damals etwa ein Video in einer WhatsApp-Gruppe von mir, in dem ich das N-Wort gesagt habe. Ich dachte daraufhin, das kann ich eigentlich nicht mehr machen. Im Laufe der Zeit hatte ich das Gefühl, dass ich online ein anderer war als im analogen Leben. Ich begann, den Content der YouTuber zu hinterfragen. Aber das hat gedauert. Als etwa Ben Shapiro in einem Video den Klimawandel leugnete, war für mich klar, dass es nicht stimmen kann, was er erzählt. Hinzu kam, dass ich Themen, die mein Leben und mich betrafen, bei den YouTubern nicht mehr gefunden habe. Sie sprachen über Kulturkampf-Themen, aber mich interessierten etwa Bafög oder finanzielle Themen. Aber dadurch, dass etwa KuchenTV viele Themen auf seinem Kanal behandelt – etwa Beef in der YouTuber-Szene –, habe ich Videos auf seinem Kanal bis zur elften Klasse angesehen. Heute würde ich sagen, dass dieser Kanal auch deshalb gefährlich ist.
Herr Hanke, wie hat sich Lennys Veränderung bemerkbar gemacht?
Hanke: Ich habe die Veränderung zu Beginn der zehnten Klasse bemerkt. Seine Nachfragen wurden gehaltvoller, konkreter und kritischer. Er fragte etwa: „Wie kann es sein, dass eine kleine Wohnung in London 2.000 Pfund pro Monat kostet?“ Mir ist dann aufgefallen, dass wir in den Diskussionen die Rollen getauscht haben. Ich habe die Gegenposition eingenommen – mit Standpunkten, die etwa die FDP oder die Union vertreten, Lenny vertrat immer häufiger eher linke Positionen.
Lüdtke: Ich kann mich an die Diskussion über den Wohnungsmarkt im Wirtschaftsunterricht erinnern. Damals habe ich für die Enteignung von Wohnungskonzernen argumentiert. Eine steile These, die ich vorher so nicht vertreten hätte. Wir haben auch einmal ein Video von dem linken Kabarettisten Volker Pispers angesehen, der die Geldwirtschaft und die Rolle der Banken polemisch problematisiert. Das fand ich damals plötzlich cool.
Hanke: Mein Ziel war es nie, Lenny von bestimmten Positionen zu überzeugen. Mir ist es wichtig, dass jeder Schüler oder jede Schülerin eine Haltung entwickelt, die er oder sie mit guten Argumenten begründen kann.
Wie schaut ihr beide heute auf diese Zeit zurück?
Hanke: In den zwei Jahren, in denen ich Lennys Klassenleiter war, habe ich mich als Lehrkraft gefestigt und mir gezeigt, was ich als Lehrkraft kann, darf und muss. Und auch, dass es Erfolg haben kann, wenn man sich respektvoll begegnet.
Lüdtke: Erst kürzlich habe ich in einem alten WhatsApp-Chat eine Nachricht von mir gelesen und mich gefragt – war das wirklich ich? Ich bin froh und dankbar, dass ich diese Phase hinter mir lassen kann. Und ich glaube, wenn ich Christian nicht getroffen hätte, wäre ich nicht da, wo ich bin. Er hat mir gezeigt, dass eine Lehrkraft einen Unterschied machen kann. Auch deshalb habe ich beschlossen, Lehramt zu studieren.
Dieser Artikel wurde zuerst auf ZEIT ONLINE am 26. Juni 2025 veröffentlicht.