Die Hausaufgaben? Macht ChatGPT. Mehr und mehr Schülerinnen und Schüler lassen sich von KI unter die Arme greifen und werden dabei immer geschickter. Für viele Lehrkräfte ein wachsendes Problem. Doch ein generelles Verbot von KI in der Schule ist für Pavle Madzirov weder durchsetzbar noch zielführend. Denn KI-Kompetenzen sind auf dem Arbeitsmarkt zunehmend gefragt. „Und warum sollten wir als Schule etwas verbieten, das für die Zukunft unserer Kinder entscheidend sein wird?“, fragt Pavle Madzirov, der Schulleiter der Sekundarschule Am Biegerpark in Duisburg.
Er und sein Kollegium gehen daher den Weg mit der künstlichen Intelligenz: Sie betrachten KI als Bildungsaufgabe und nutzen die neuen Möglichkeiten zugleich für die eigenen täglichen Aufgaben. Wie genau die ganzheitliche Nutzung im Alltag der Schule Am Biegerpark aussieht und welche Hürden es noch gibt – ein Überblick.
Wofür nutzen Lehrkräfte und Verwaltung KI?
Vornehmlich zur Unterrichtsvorbereitung. In der Verwaltung unterstützt KI etwa bei der Kommunikation, konkret bei der Formulierung von E-Mails und der Vorbereitung von Elterngesprächen, aber auch bei der Erstellung von Konzepten und in der Schulentwicklung. Dazu wurden etwa die anonymisierten Ergebnisse der Klassenarbeiten der letzten Jahre mittels KI analysiert, erläutert Madzirov. „Unsere Aufgabe ist es nun, aus den interessanten Befunden Schulentwicklungsmaßnahmen abzuleiten.“

Wie werden Schülerinnen und Schüler an KI herangeführt?
Einmal im Monat gibt es außerhalb der Unterrichtszeit eine freiwillige Veranstaltung, bei der die neuesten KI-Tools vorgestellt werden. Im vergangenen Schuljahr hat das Kollegium auch damit begonnen, das Thema KI in die Lehrpläne aller Jahrgangsstufen zu integrieren. In Geschichte etwa chatten die Jugendlichen mit historischen Persönlichkeiten, was komplexe Zusammenhänge greifbarer macht. In Philosophie setzen sie sich mit der ethischen Dimension von künstlicher Intelligenz auseinander. „Da es noch keine gesetzliche Grundlage gibt, an der wir uns orientieren können, vollzieht sich diese Integration sukzessive und ist am Anfang natürlich etwas aufwendig“, sagt Madzirov. „Aber man merkt, dass das Thema die Schülerinnen und Schüler bewegt und wir insofern auf dem richtigen Weg sind.“
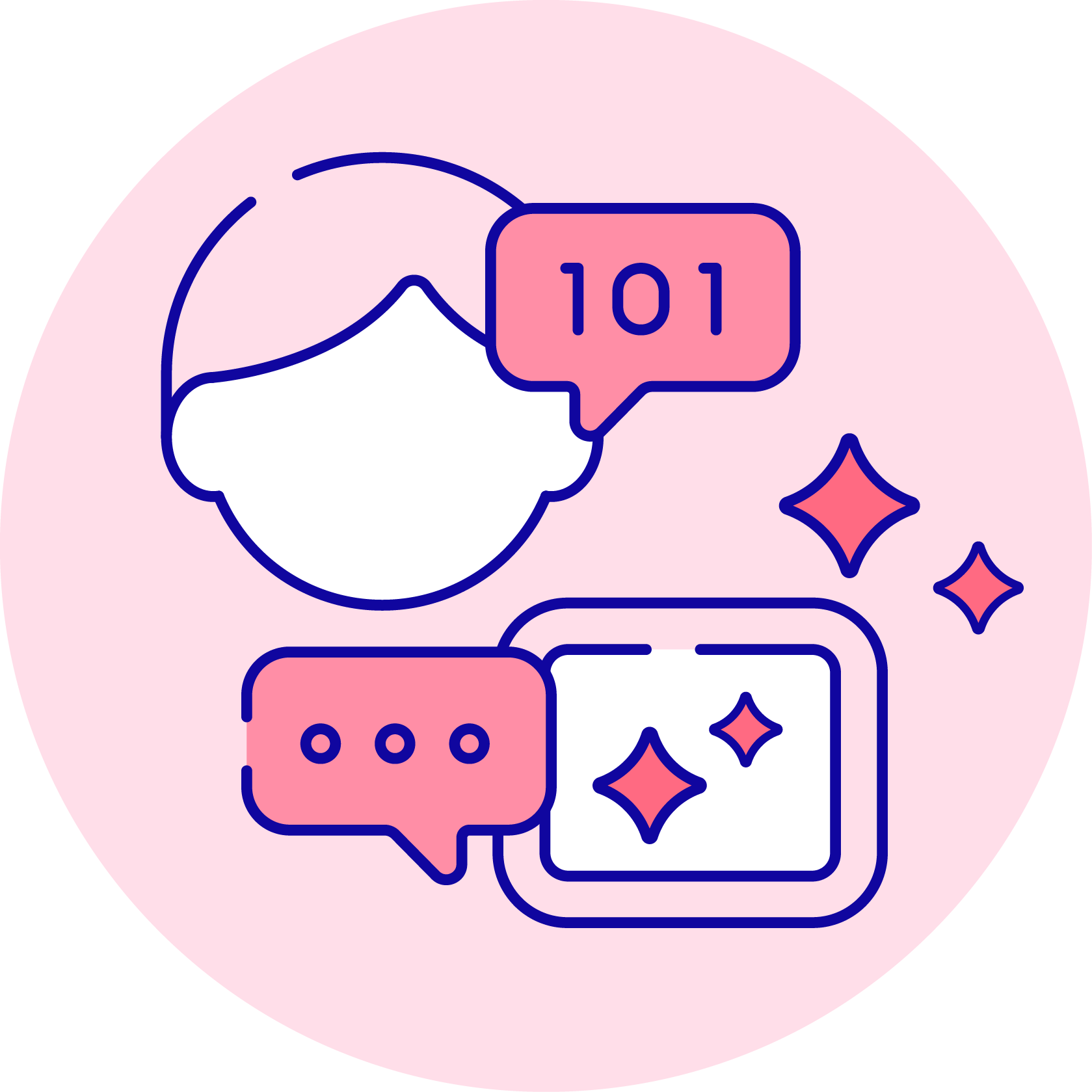
Wie kann KI beim Lernen unterstützen?
Der größte Vorteil von KI für Madzirov: Sie eröffne völlig neue Möglichkeiten des personalisierten Lernens, könne orientiert an den Interessen der Schülerinnen und Schüler quasi auf Knopfdruck individualisierte und motivierende Arbeitsmaterialien erstellen, so der Schulleiter. „Der Anspruch auf individuelle Förderung kann mit KI endlich eingelöst werden.“ Madzirov und seine Kolleginnen und Kollegen haben daher auf Basis von ChatGPT einen KI-Lernbuddy erstellt, mit dem die Kinder etwa Bruchrechnen üben oder sich auf Prüfungen vorbereiten können. Verwenden dürfen sie das Tool allerdings nur privat. Denn aus Datenschutzgründen sind offene KI-Plattformen wie ChatGPT auf Schul- und Dienstrechnern bislang tabu. In einem nächsten Schritt hat die Schule im Rahmen eines Pilotprojekts einen eigenen datenschutzkonformen KI-Chatbot aufgesetzt. Er basiert auf der französischen Plattform Mistral, die Server werden von der Schule selbst betrieben, nicht von einem Anbieter aus Übersee, wie Madzirov betont: „Unser lokaler Chatbot mag zwar nicht so leistungsfähig sein wie ChatGPT, bietet aber in jedem Fall einen guten und vor allem sicheren und rechtskonformen Einstieg in die KI.“
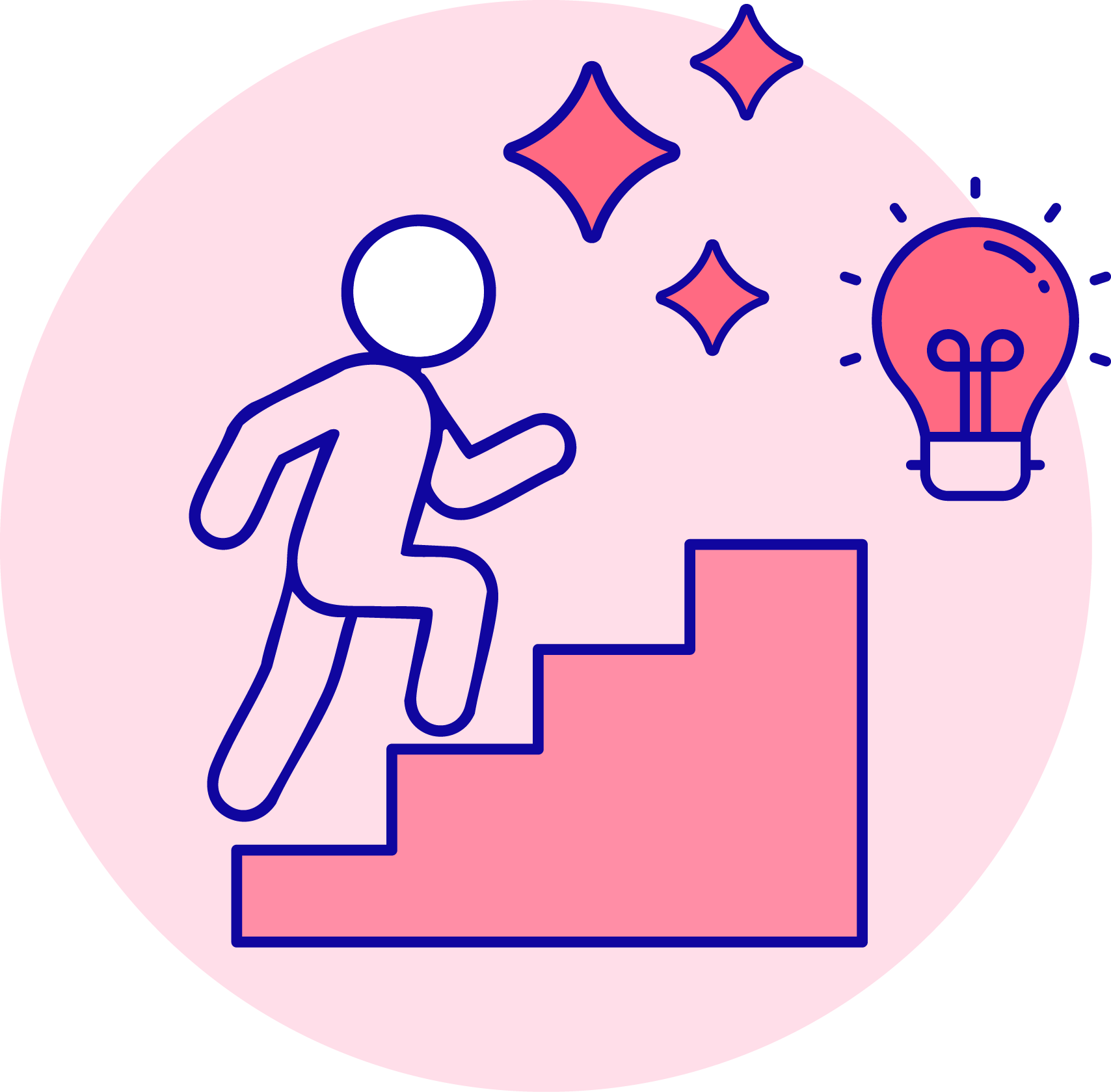
Wie schafft man es als Schule, das Kollegium in Sachen KI mitzunehmen?

Setzen die Lehrkräfte KI auch im Unterricht ein?

Welche Richtlinien legen die KI-Nutzungsbedingungen fest?
KI-generierte Texte als die eigenen auszugeben ist natürlich verboten. Darüber hinaus hat sich die Schule bewusst wenige fixe Richtlinien gegeben. „Die Entwicklung im KI-Bereich ist so schnell, dass jede eng gefasste Regel morgen schon wieder überholt ist“, konstatiert Pavle Madzirov. Die Nutzungsbedingungen werden daher kontinuierlich überarbeitet und angepasst. „Bis es auf Länderebene eine klare Regelung zur KI-Nutzung gibt, muss das jede Schule selbst anpacken“, sagt Madzirov. Durch die Handlungsempfehlungen der Kultusministerkonferenz gebe es nun aber auch einen ersten Rahmen, an dem sich Schulen dabei orientieren können.

Wie lassen sich Prüfungsformate anpassen, um einem möglichen Missbrauch entgegenzuwirken?
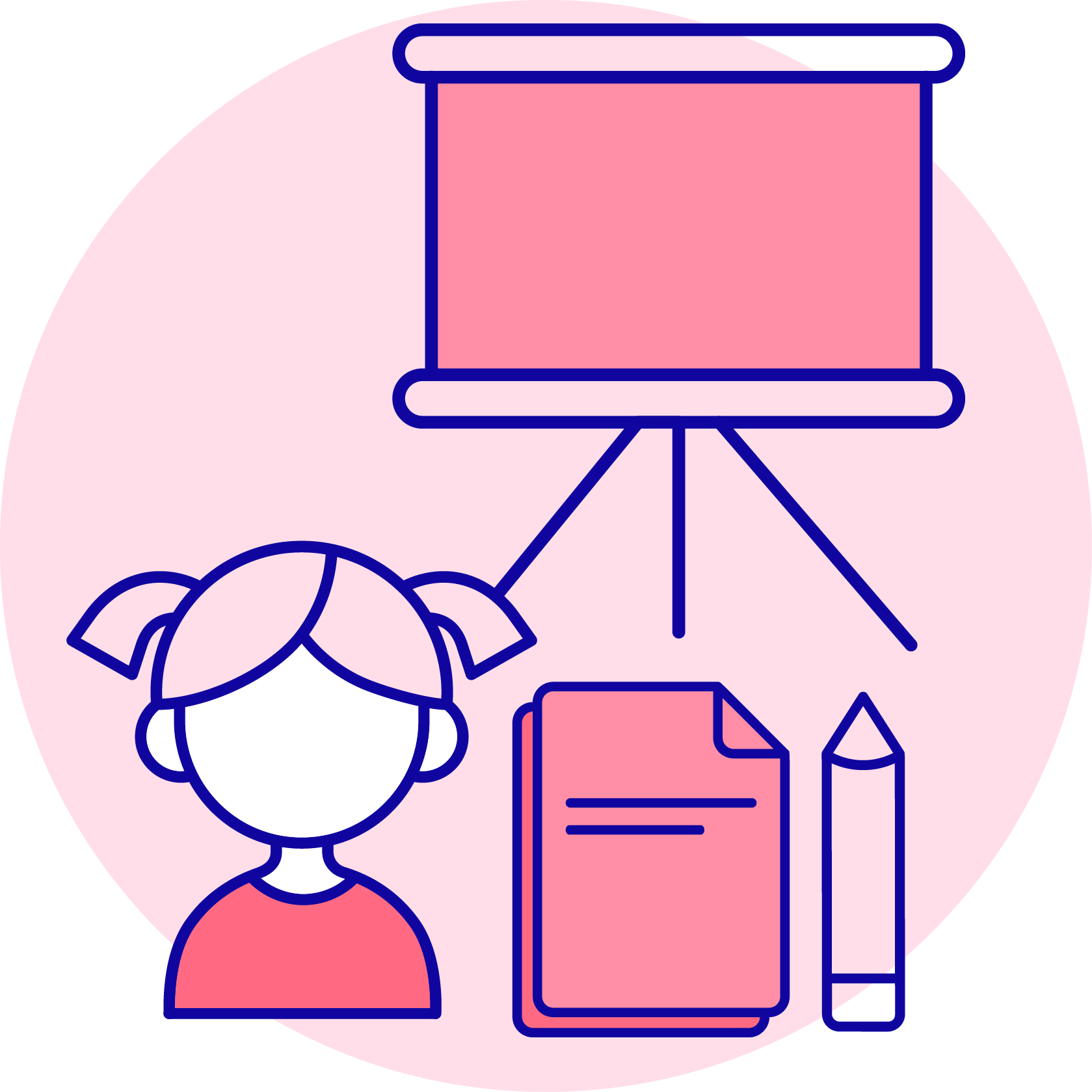
Welche besonderen Herausforderungen und Chancen gibt es für den KI-Einsatz an Schulen im Brennpunkt?
Viele Verwaltungsvorgänge wie Krankmeldungen und Vertretungsplanung könnten Madzirov zufolge künftig durch KI automatisiert und das Personal so entlastet werden. Auch die neuen Möglichkeiten zur individuellen Förderung bieten große Chancen, insbesondere für Schulen im Brennpunkt. Noch seien diese Chancen aber sehr ungleich verteilt, problematisiert der Schulleiter: „Wenn ein Kind über das Elternhaus Zugang zu einem Bezahl-Tool hat, hat es deutlich mehr Vorteile als ein Kind, das auf die Basisversion beschränkt ist.“ Ein Problem, das auch die Kultusministerkonferenz adressiert. Man wolle „zeitnah eine ländergemeinsame Schnittstellenlösung zum datenschutzkonformen und kostenfreien Zugang“ zu KI-Modellen im schulischen Bereich bereitstellen, heißt es in der Handlungsempfehlung des Gremiums aus dem Oktober 2024. Darüber hinaus visieren die Länder auch den Aufbau eines eigenen, speziell für pädagogische Zwecke trainierten KI-Modells für Schulen an. Um alle Schulen – besonders jene im Brennpunkt – fit fürs KI-Zeitalter zu machen.
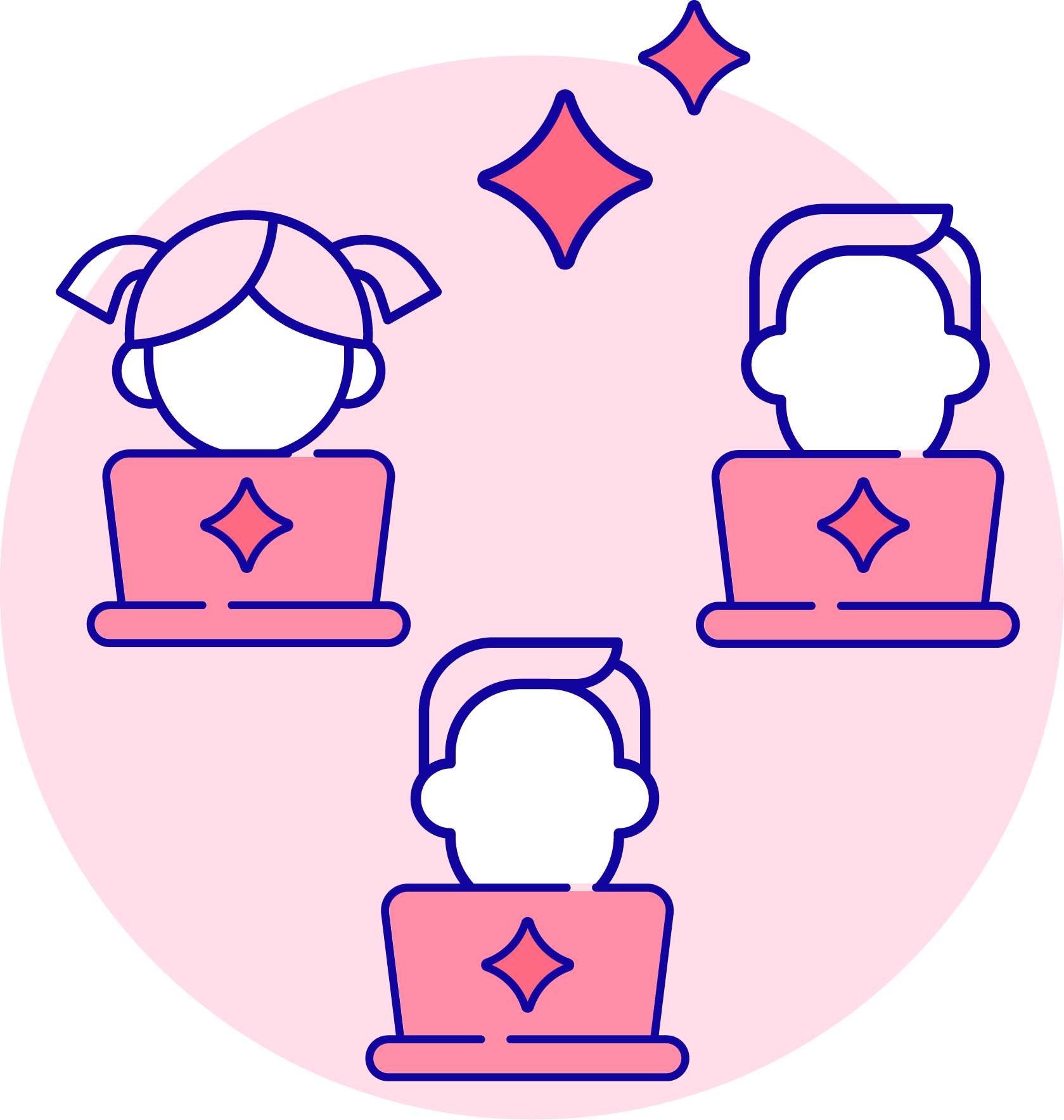

Pavle Madzirov ist Schulleiter der Sekundarschule Am Biegerpark in Duisburg. Seine Schule wurde 2024 vom Digital-Verband Bitkom als Leuchtturmschule für künstliche Intelligenz ausgezeichnet.
