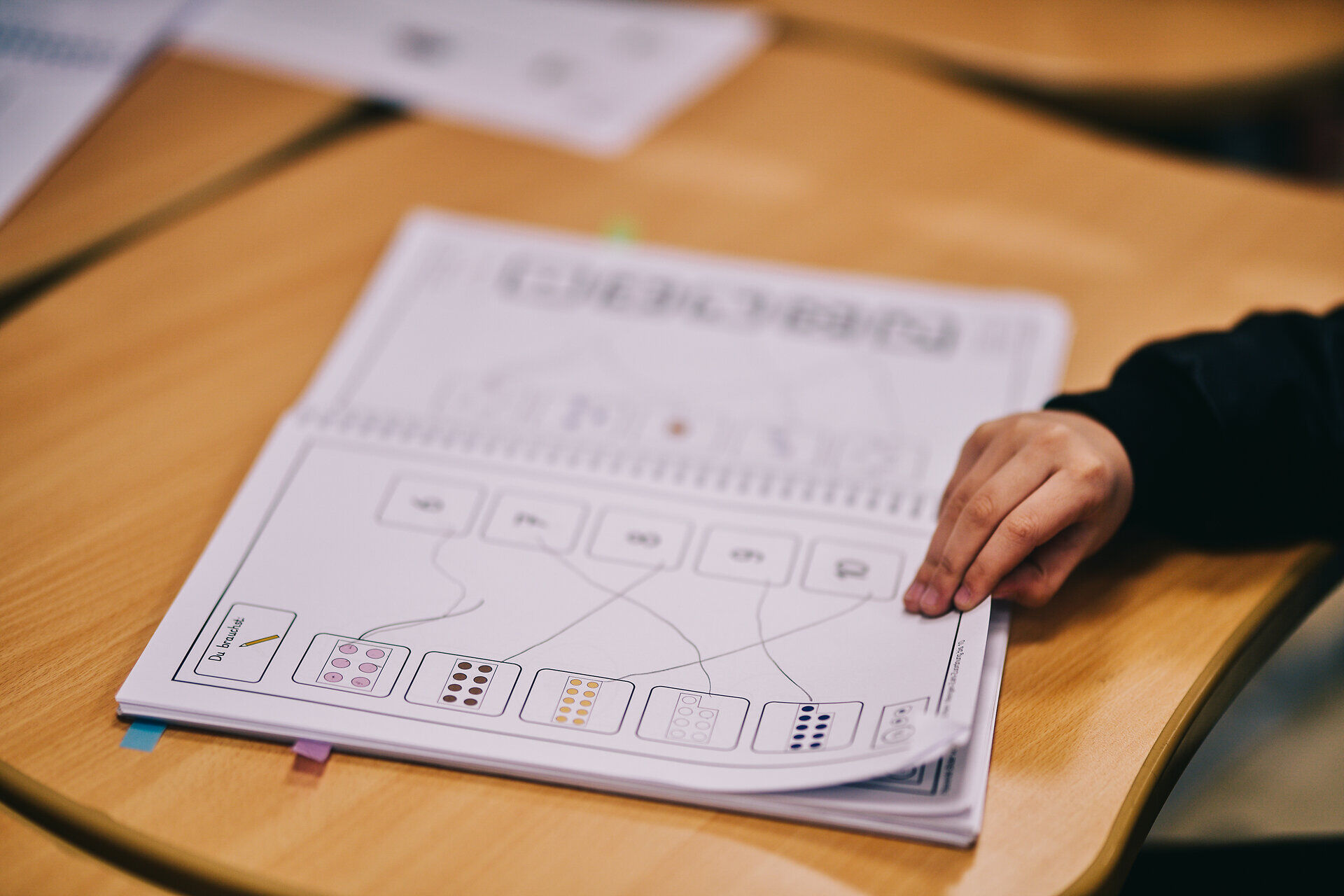Die neue Bundesregierung hat sich mit ihrem Koalitionsvertrag bei der Bildung einiges vorgenommen. Ganz gleich, ob es die messbaren Ziele mit einer Schüler-ID, der Digitalpakt 2.0 oder der Ausbau des schulischen Ganztages sind, der Bund kann nur erfolgreich sein mit den für Bildung verantwortlichen Ländern. Auf die Agenda wurde eine „bürokratiearme“ Weiterentwicklung des Startchancen-Programms gesetzt. Es handelt sich dabei um eine in vielen Runden zwischen dem Bund und den Ländern verabredete Unterstützung von 4000 Schulen, an denen besonders viele Schülerinnen und Schüler aus sozioökonomisch benachteiligten Familien lernen.
Das Programm hat eine Laufzeit von zehn Jahren und besteht aus drei sogenannten Säulen, die Infrastrukturmaßnahmen (Säule 1), ein finanzielles Budget für Schul- und Unterrichtsentwicklung („Chancenbudget“, Säule 2) sowie eine zusätzliche Kraft für das multiprofessionelle Team der Schulen (Säule 3) abdecken. Die Erwartungshaltungen an den Schulen wurden gerade von den im Bund Verantwortlichen mächtig geschürt. Vom „größten Bildungsprogramm in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland“ war immer wieder die Rede. Der Eindruck wurde erweckt, dass dieses Programm nicht nur fast alle Wünsche erfüllen, sondern genauso rasch die Probleme lösen würde, die Vergleichsstudien wie die Bildungstrends des Instituts für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) oder die internationalen PISA-Vergleichsstudien in Schule und Unterricht aufdecken. Die geweckten Hoffnungen treffen nun, da das Programm verwirklicht werden soll, auf die vermeintlich notwendigen Anforderungen der Bürokratie in den Ländern.
Das Bürokratiemonster zähmen
Pauschale Aussagen sind gegenwärtig nicht möglich, da die Ausgestaltung des Programms in den Bundesländern sehr unterschiedlich ist, was nicht unbedingt schlecht sein muss. So unterscheidet sich die Höhe des sogenannten Chancenbudgets pro Schule zwischen den Ländern zum Teil stark, wie auch die Antragsverfahren. Es gibt Länder, die es den Schulen überlassen, was sie mit dem Geld machen. Andere haben einen verbindlichen Katalog erarbeitet, aus denen die Schulen Maßnahmen auswählen können, und andere, die einen solchen Katalog als unverbindliche Orientierung anbieten. Mit der Abwicklung der Mittel unterscheiden sich offenbar auch die Dokumentations- oder gar Ausschreibungspflichten. Allerdings lässt die Bund-Länder-Vereinbarung den Ländern gerade beim Chancenbudget für die Schul- und Unterrichtsentwicklung und der zusätzlichen Kraft für das multiprofessionelle Team viele Spielräume. Darüber haben Bund und Länder auch lange verhandelt. Es gibt damit im Grunde nicht das eine, sondern 16 Programme, sodass eine einheitliche Aussage über überbordende Bürokratie schwerfällt.
Tatsächlicher Bedarf von annähernd 55 Milliarden Euro
Das gilt grundsätzlich auch für die Verwendung der Mittel für die Infrastrukturmaßnahmen, wo ebenfalls viel Flexibilität für das immerhin zehnjährige Programm besteht. Diese Säule sorgte von Beginn an für die meisten Diskussionen. Denn im Startchancen-Programm haben sich alle 16 Bundesländer darauf verständigt, die Anzahl der Schülerinnen und Schüler zu halbieren, welche die Mindeststandards im Bereich Deutsch und Mathematik nicht erreichen. Allerdings hat das Programm einen sichtbaren Webfehler. So sinnvoll messbare Ziele in einem großen Bildungsprogramm sind, so zeigt sich hier, dass der zweite vor dem ersten Schritt gemacht wurde. Denn ganz offensichtlich wurden zuerst die drei Säulen beschlossen und erst danach wurden die Ziele formuliert. Eigentlich sollte es umgekehrt sein: Was braucht es, um ein Ziel zu erreichen?
Für die damalige Hausspitze des Bundesbildungsministeriums stand jedoch von Beginn an fest, dass es eine Säule für Infrastrukturmaßnahmen geben sollte, obwohl zahlreiche Fachleute darauf hingewiesen hatten, dass einerseits ein erheblicher Investitionsbedarf im Schulbau besteht, andererseits ein solches Programm mit vergleichsweise geringen Mitteln für Baumaßnahmen keinen echten Mehrwert bietet. Und obwohl keine unmittelbar absehbare Wirkung auf die Verbesserung der Lese-, Schreib- und Rechenfähigkeiten erkennbar war, wurde geradezu stur an den Bauvorhaben festgehalten. Diese Säule macht das Programm wesentlich komplizierter.
Die Summe für diese Säule beläuft sich in zehn Jahren auf vier Milliarden Euro Bundesmittel. Angesichts des von der KfW-Bank geschätzten, tatsächlichen Bedarfs für den Schulbau von annähernd 55 Milliarden Euro ist das deutlich zu wenig. Die neue Hausspitze des Ministeriums für Bildung und Familie könnte nun diese Säule unvoreingenommen infrage stellen, auch auf die Gefahr hin, dass es in den Ländern bereits sehr viele Überlegungen dazu gegeben hat und Prozesse für die Verwendung definiert worden sind. Raus aus den Pantoffeln, rein in die Pantoffeln, das kommt in der Regel nicht gut an.
„So sinnvoll messbare Ziele in einem großen Bildungsprogramm sind, so zeigt sich hier, dass der zweite vor dem ersten Schritt gemacht wurde.“
Dr. Markus Warnke, Geschäftsführer der Wübben Stiftung Bildung
Säule 1 aufgeben – in Säule 2 investieren
Allerdings läuft das Programm gerade erst langsam an und viele Ministerien auf Landesebene tun sich schwer, die Kommunen systematisch einzubinden. Land und Kommunen sind eben zwei unterschiedliche Verwaltungseinheiten. Hinzu kommt, dass es in Deutschland einfach kompliziert ist und lange dauert, bis gebaut werden kann. Neben den langwierigen Verfahren ist es auch der vorgesehene finanzielle Eigenanteil der ohnehin klammen Kommunen, der das ganze Programm spürbar lähmt. Sinnvoller wäre stattdessen das ebenfalls im neuen Koalitionsvertrag mit nur einem Satz angedeutete Geld für die Schulsanierung, „um bei der Sanierung und Substanzerhaltung von Schulen und der Schaffung neuer Kapazitäten zu unterstützen“.
Ein großer Topf, so wäre es vorstellbar, gespeist aus Mitteln des Bundes, der Länder und der Kommunen, aus dem in der nächsten Dekade in alle Schulen ordentlich investiert werden kann. Ein solcher Kraftakt könnte die Schulen wieder auf Vordermann und zum Ausdruck bringen, dass Bildung die wichtigste Ressource in diesem Land ist. Die erste Säule könnte daher mit Verweis auf die Mittel für Schulbau und -modernisierung aus dem Programm gestrichen werden und entweder ganz oder teilweise in die zweite Säule fließen.
Die beiden anderen Säulen hingegen decken den Bedarf der Schulen im Brennpunkt ab. Ihn hat die Wübben Stiftung Bildung, wie erstmalig vor zwei Jahren, nun abermals ermittelt. Wir versuchen damit, zu beschreiben, was die Situation an diesen Schulen so herausfordernd macht. 226 Schulleitungen aus vier Bundesländern haben sich an der Befragung „Schule im Brennpunkt 2025“ beteiligt. Viele Ergebnisse der Studie wären es wert, näher betrachtet zu werden. Dazu gehört die Feststellung, dass etwa 70 Prozent der Schulleitungen den Schülern bei Schuleintritt viel Unterstützung bei den Sprachkompetenzen, Fachkompetenzen und sozio-emotionalen Kompetenzen geben müssen, dass jedes vierte Kind länger in der Grundschule bleibt und es Schulen gibt, bei denen das 90 Prozent der Kinder betrifft. Auch passen nach Einschätzung von etwa 70 Prozent der Schulleitungen die Lehrpläne und die gängigen Lehrwerke einfach nicht zu den Voraussetzungen und Möglichkeiten ihrer Schülerschaft. Allein diese Befunde zeigen, wie erschwert die Lernbedingungen an diesen Schulen sind und wie richtig es ist, dass die Politik verstärkt darauf schaut.
Datengestützte Schulentwicklung vorantreiben
Auf die Frage nach ihren Bedarfen beim Startchancen-Programm sehen die befragten Schulleitungen diese insbesondere bei der individuellen Förderung der Schülerinnen und Schüler (87 Prozent) und bei der Schul- und Unterrichtsentwicklung (89 Prozent). Genau hier sollte der Schwerpunkt im Startchancen-Programm liegen. Die Länder sollten sich also auf die Maßnahmen konzentrieren (können), die ein zentrales Ziel des Programms direkt beeinflussen: die Lern- und Leistungsentwicklung der Schülerinnen und Schüler. Die Infrastruktursäule gehört nicht dazu.
Wir haben die Schulleitungen auch gefragt, wie sie die ambitionierten Ziele des Programms einschätzen. Ganze 65 Prozent glauben daran, dass sich in den nächsten zehn Jahren die Anzahl der Kinder halbieren lässt, die Mindeststandards in Deutsch und Mathematik nicht erreichen. Bei der Stärkung der sozial-emotionalen Entwicklung der Schülerinnen und Schüler sind sogar über 90 Prozent von einem Erfolg überzeugt. Auch gehen über 80 Prozent der Schulleitungen davon aus, dass sich die Qualität des Unterrichts substanziell verbessern wird. Diese Zahlen dokumentieren eine schon fast unglaubliche Zuversicht der Schulleitungen. Offenbar schrecken die klar formulierten Ziele des Programms diejenigen nicht ab, die es in den Schulen umsetzen müssen.
Die neue Bundesregierung will gemeinsam mit den Ländern in der nächsten Dekade die datengestützte Schulentwicklung vorantreiben. Messbare Ziele, wie im Startchancen-Programm, sollen dabei helfen. Wer die Bildungswende will, darf aber nicht nur auf die leistungsschwachen, sondern muss auch auf die leistungsstarken Schüler schauen. Die Kontrolle der individuellen Lernverläufe mithilfe einer Schüler-ID würde diesen Prozess wesentlich erleichtern. Die Länder haben sich mit dem Startchancen-Programm schon auf den Weg gemacht und überprüfbare Ziele für die schwächste Gruppe von Kindern und Jugendlichen definiert, folgerichtig wäre nun auch der nächste Schritt, der eine Verbesserung bei wirklich allen Schülerinnen und Schülern nachvollziehbar macht, damit sich Deutschland in den nächsten zehn Jahren daran messen lassen kann.

Dr. Markus Warnke ist seit 2013 Geschäftsführer der Wübben Stiftung Bildung. Zuvor war er im Kinder- und Jugendministerium von Nordrhein-Westfalen sowie als Bundesgeschäftsführer beim Familienbund der Katholiken in Berlin tätig.