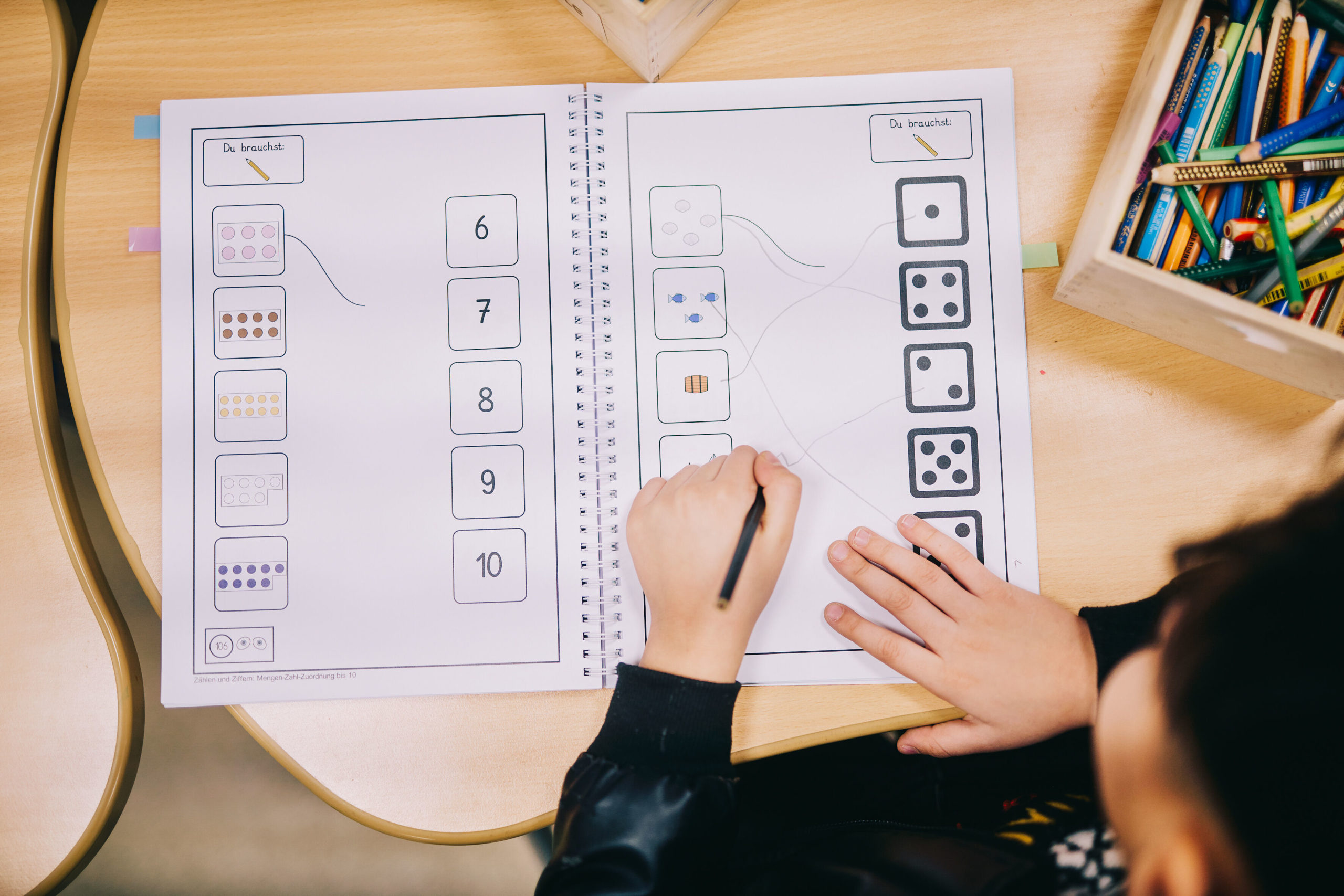„Qualität der Schulen verschlechtert sich weiter“, „Schulqualität nimmt weiter ab“ – das sind nur zwei der Überschriften aus der Vorabberichterstattung zum Bildungsmonitor 2025, der am heutigen Dienstag offiziell veröffentlicht wird. Im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) ermittelt das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln anhand einer Vielzahl von Bildungsdaten und Statistiken jedes Jahr unter anderem ein Länder-Ranking. Ob Bildungsmonitor, IQB-Bildungstrend oder internationale Bildungsvergleiche: Regelmäßig werden Untersuchungen zu den Leistungen von Schülerinnen und Schülern negativ betitelt. Ein etwas älteres Beispiel: „PISA-Studie – Deshalb sind Deutschlands Schulen so schlecht“.
Schlechte Schülerleistungen = schlechte Schulen, diese Gleichung scheint simpel, und sie kann stimmen. Oder komplett in die Irre führen. Häufig wissen wir es nämlich gar nicht! Richtig ist, dass das Leistungsniveau von Schülerinnen und Schülern in Deutschland in den vergangenen zehn Jahren in den meisten Kompetenzbereichen gesunken ist. Dies weisen seit Jahren nicht nur der Bildungsmonitor, sondern vor allem der IQB-Bildungstrend, auf dessen Primärergebnisse sich das IW zu einem guten Stück stützt, nach. Doch sind daran die Schulen schuld? Sind die Schulen schlecht(er)?
Veränderte Startbedingungen verzerren die Ergebnisse
Grundsätzlich ist eine regelmäßige, auch flächendeckende Erhebung der Leistungen von Schülerinnen und Schülern wichtig und richtig. Die von den Ländern beschlossenen und am IQB weiterentwickelten Bildungsstandards bieten eine besonders gute Grundlage für solche Erhebungen, denn sie definieren faktische Messlatten, um Stärken und Schwächen der Schülerinnen und Schüler in Deutschland abzubilden.
Dabei sind jedoch auch die deutlich veränderten Bedingungen an den Schulen zu berücksichtigen, die in den vergangenen Jahren wesentlich anspruchsvoller geworden sind. Zu nennen sind der starke Zuzug nach Deutschland seit dem Jahr 2015 mit einer weiteren Spitze zu Beginn des Krieges Russlands gegen die Ukraine. Hinzu kommen die wesentlich stärkere Nutzung von sozialen Medien durch Kinder und Jugendliche, die immer noch spürbaren Nachwirkungen der Corona-Pandemie etwa auf die mentale Gesundheit, die Zunahme von diagnostizierten Förderbedarfen sowie die sich wandelnde Rolle und Erwartungshaltung von Eltern. All dies sind Themen, die den Schulalltag heute prägen. Und es gibt Schulen, an denen sich besonders viele dieser Herausforderungen konzentrieren.
Die Bildungsstandards und die Lehrpläne in den Bundesländern gehen von Startvoraussetzungen aus, die viele Kinder so nicht beziehungsweise nicht mehr mitbringen. Das macht die Lernziele nicht falsch, aber für die Kinder je nach ihrer Ausgangslage unterschiedlich schwer erreichbar.
Vom Seepferdchen zum Freischwimmer
Vergleichen wir die Schule mit dem Schwimmunterricht und setzen wir das Ziel, am Ende der Grundschulzeit das Bronze-Abzeichen zu erlangen, den Freischwimmer. Dabei wird angenommen, dass die Kinder aus dem Kindergarten bereits das Seepferdchen in die Grundschule mitbringen. In Wirklichkeit aber gibt es Kinder, die dieses Abzeichen noch nicht haben, die noch nie in einem Schwimmbad waren oder sogar mit einem Rucksack von Traumata ins Wasser müssen, etwa nach einer Flucht über das Meer.
An allen Schulen überall am Land steigt die Zahl der Kinder mit sehr unterschiedlichen Startvoraussetzungen, die alle ins gleiche Becken geschubst werden. Deshalb sollten wir nicht am Ziel, hier dem Freischwimmer, rütteln oder es abschaffen. Wir müssen jedoch darüber nachdenken, wie wir den Schwimmunterricht so organisieren können, damit alle Kinder ihn schaffen können.
Um das Bild des Schwimmunterrichts wieder zu verlassen: Alle Kinder besuchen den gleichen Mathe- oder Deutschunterricht. Alle sollen dieselben Lernziele erreichen, und das ist richtig so, denn alle Kinder haben dasselbe Grundrecht auf Bildung. Aber zu diesem Grundrecht gehört, dass wir Bildung so gestalten, dass alle Kinder mitkommen können.
Die Schule allein war und ist damit überfordert, ausschlaggebend ist dabei die Rolle der Eltern. Doch so sehr wir deshalb über Wege und Methoden nachdenken müssen, um alle Familien stärker einzubinden und in die Pflicht zu nehmen, am Ende ist auch klar: Viele Eltern werden ihren Kindern bei schulischen Dingen nie so effektiv helfen können wie andere. Also gilt: Auch wenn Schulen allein nicht das Leistungsniveau heben können, haben sie dennoch einen entscheidenden Einfluss.
An einigen Schulen lernen besonders viele Kinder und Jugendliche aus sozioökonomisch benachteiligten Familien mit schwierigen Ausgangsbedingungen lernen. Sie starten nicht bei null, sondern eher bei minus fünf. Dass die Schulen bei Vergleichsstudien und -tests dann regelmäßig schlecht abschneiden, ist für sie nicht nur klar, sondern auch frustrierend. Die ungleichen Startbedingungen der Kinder und die unzureichenden Möglichkeiten erschweren es den Schulen, auf die Unterschiedlichkeit der Kinder und Jugendlichen einzugehen und sie zum vorgegebenen Lernziel zu führen.
„Die ungleichen Startbedingungen der Kinder und die unzureichenden Möglichkeiten erschweren es den Schulen, auf die Unterschiedlichkeit der Kinder und Jugendlichen einzugehen und sie zum vorgegebenen Lernziel zu führen.“
Dr. Markus Warnke, Geschäftsführer der Wübben Stiftung Bildung
Daten sind die Basis für gezielte Förderung und Weiterentwicklung
Dazu ist ein besseres Wissen darüber notwendig, ob der Unterricht und die schulischen Lerngelegenheiten positiv auf das Lernen und die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler wirken. Das gilt übrigens für alle Schulen. Wobei eine gute Schule dann diejenige wäre, die den größten Leistungszuwachs bei ihren Schülerinnen und Schülern erreicht und wo die Kinder am meisten dazulernen – unabhängig von ihrer Herkunft.
In Deutschland fehlt jedoch bis heute eine flächendeckende Diagnostik im frühkindlichen Bereich ebenso wie eine systematische Erfassung der individuellen Lernverläufe. Gäbe es sie, würden die Unterschiede zu Beginn und die Entwicklungen im Laufe der Bildungsbiografie deutlich. Dann würden endlich auch die relativen Lernerfolge sichtbar. Gerne würden gerade die Schulen im Brennpunkt zeigen, was sie bewirken. Die bisherigen Lernstandserhebungen und die prominenten Schulleistungsstudien können das in der Regel nicht abbilden.
Eine aktuelle Befragung der Wübben Stiftung Bildung, an der 226 Schulleitungen an Schulen im Brennpunkt aus vier Bundesländern teilgenommen haben, zeigt, dass über 80 Prozent der Befragten motiviert sind, mit Daten Unterricht und Schule weiterzuentwickeln. Dazu braucht es aus meiner Sicht gute Diagnoseinstrumente, eine kontinuierliche Erfassung von Bildungsverläufen und idealerweise eine Bildungs-ID, wie sie von der schwarz-roten Bundesregierung im notwendigen Benehmen mit den Ländern angekündigt wurde. Was die Datenlage von Bildungsverläufen der Schülerinnen und Schüler in Deutschland angeht, sind wir im internationalen Vergleich schlecht aufgestellt.
Auf einer soliden Datenlage könnten wir zielgenauer schauen, an welchen Schulen unter welchen Bedingungen es besonders gut oder schlecht gelingt, Kinder und Jugendliche auf ihrem Bildungsweg zu unterstützen. Und erst dann können wir die Unterstützung und Aufmerksamkeit an Schulen so organisieren, dass sie den Bedarf decken und wirksames Lernen fördern. Gerade in Zeiten knapper Kassen ist das alles eigentlich schon längst nicht nur ein Gebot der Effektivität, sondern auch der Effizienz. So schaffen wir die Grundlage, für eine bessere Bildung in den nächsten zehn Jahren.
„Schlechte Schülerleistungen = schlechte Schulen“? So einfach ist die Gleichung eben nicht. Wer nur auf die absoluten Testergebnisse starrt, übersieht die Startbedingungen, die Herausforderungen und auch die Fortschritte, die viele Schulen tagtäglich unter schwierigen Umständen ermöglichen. Vielleicht wäre es an der Zeit für eine differenziertere Berichterstattung und warum nicht auch einmal für eine wertschätzende Schlagzeile.
Dieser Artikel wurde zuerst im Blog von Jan-Martin Wiarda am 9. September 2025 veröffentlicht.

Dr. Markus Warnke, ist seit 2013 Geschäftsführer der Wübben Stiftung Bildung. Zuvor war er im Kinder- und Jugendministerium von Nordrhein-Westfalen sowie als Bundesgeschäftsführer beim Familienbund der Katholiken in Berlin tätig.