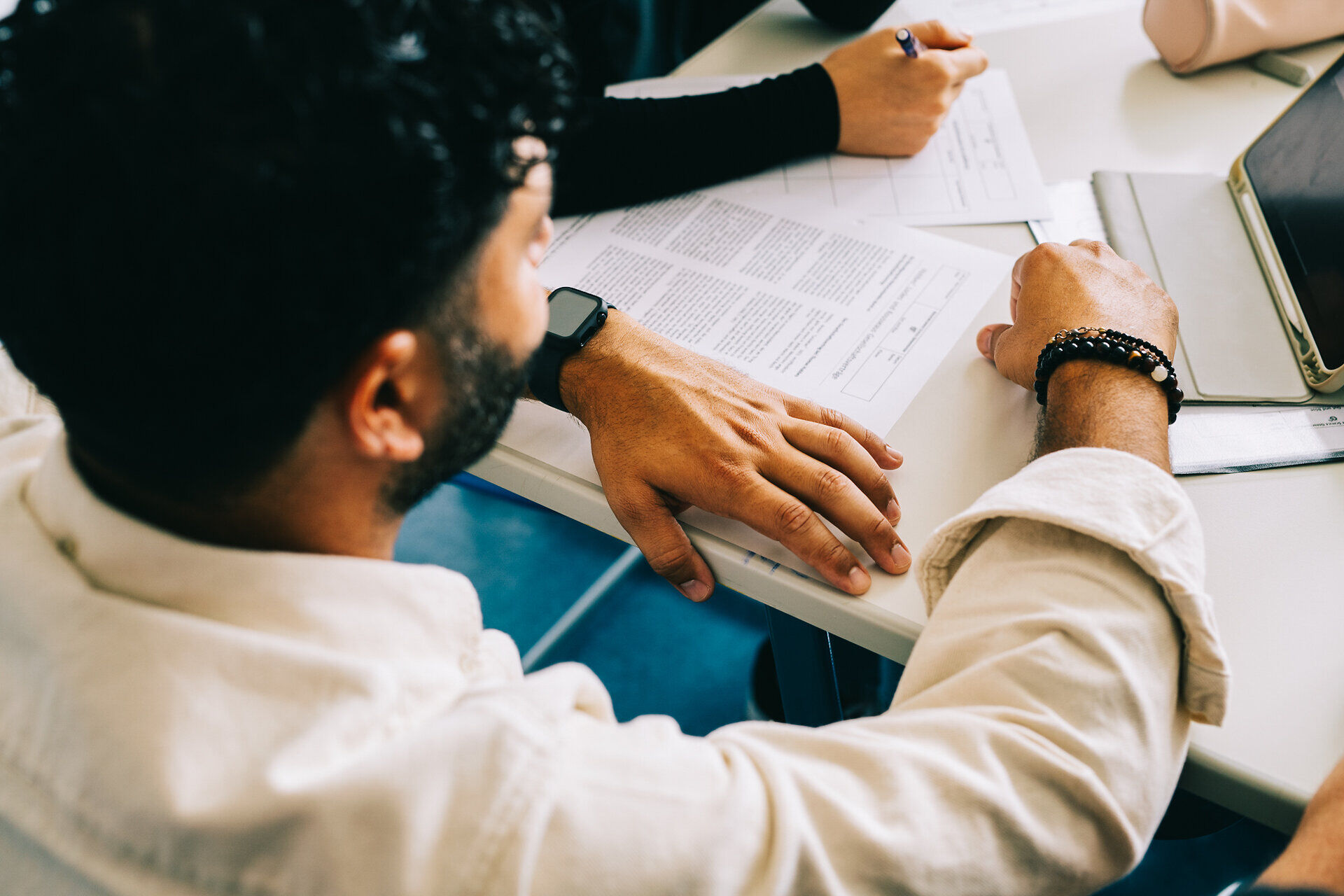Nehmen wir an, ein Schüler behauptet im Unterricht, die meisten ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger seien kriminell. Ist das vom Grundrecht der Meinungsfreiheit gedeckt?
Und Wie?
Yumurtacı: Ich würde fragen, wie der Schüler zu der Aussage kommt, welche Belege er anführen kann. Ich würde die These zum Unterrichtsgegenstand machen und ihr mit der Klasse auf den Grund gehen. Wir würden besprechen, wo wir Informationen und Statistiken finden, um die Aussage zu überprüfen. Also einfach nur zu sagen, dass die Aussage falsch ist, wäre problematisch, weil diese damit nicht widerlegt würde.
Viele Lehrkräfte sind aber verunsichert, wie sie sich in solchen Situationen verhalten sollen, und verweisen auf das Neutralitätsgebot. Was ist da dran?
„Schülerinnen und Schüler müssen in die Lage versetzt werden, sich eine politische Meinung zu bilden.“
Haluk Yumurtacı, Lehrer an der Berufsbildenden Schule in Germersheim.
Warum hält sich dieser Mythos trotzdem so hartnäckig?
Demokratische Werte zu vermitteln, ohne die persönliche Meinung in den Mittelpunkt zu stellen, könnte zum Balanceakt werden.
Mit Fakten befähigt man Schülerinnen und Schüler, sich eine politische Meinung zu bilden?
Wie nähern Sie sich Schülerinnen und Schülern mit extremistischen Einstellungen?
Manch unangenehme Diskussion und kritische Themen sparen Lehrkräfte aus Unsicherheit aber lieber aus …
Wären da nicht das Zeitproblem und die vollen Lehrpläne.
Aber die Themen werden immer vielfältiger: von Kriegen bis zum Klimawandel. Wie können sich Lehrkräfte all diesen Anforderungen stellen?


In Diskussionen mit Schülerinnen und Schülern geht es schon mal hitzig zu. Welche Rolle sollten Lehrkräfte dabei einnehmen?
Yumurtacı: Als Lehrkraft muss ich mit meinem Wissen auf Fragen eingehen. In Diskussionen bin ich nicht nur Moderator, sondern auch Mediator. Doch die wichtigste Kompetenz, die Lehrkräfte abgesehen vom Fachwissen mitbringen sollten, ist Empathie. Ohne Beziehung kann Bildung nicht funktionieren.

Haluk Yumurtacı ist Lehrer für Philosophie/Ethik, Sozialkunde, Islamische Religion und Deutsch als Zweitsprache an der Berufsbildenden Schule in Germersheim. Außerdem ist er Mediator, Traumapädagoge und Autor des Ratgebers „Anti-Rassismus für Lehrkräfte“. Auf seinem Instagram-Account @vallahbestelehrer thematisiert er unter anderem Mobbing, Rassismus und Beziehungsarbeit.