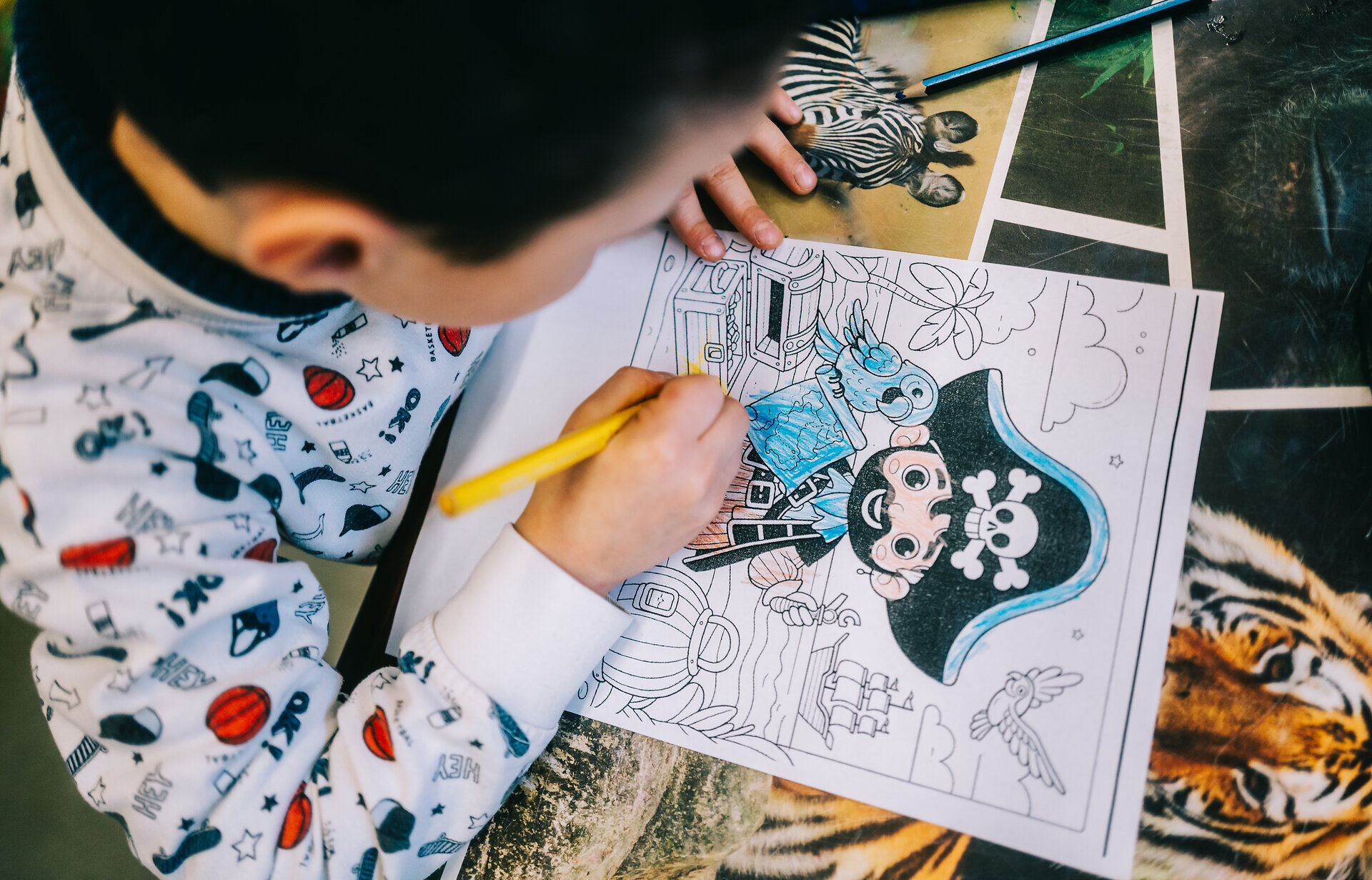Zu wenige Kitaplätze – viele Familien können von diesem Problem ein Lied singen. Das Jahr 2013 sollte eine Verbesserung für viele Eltern markieren, als die Betreuungsgarantie für Kinder ab dem zweiten Lebensjahr in Kraft trat. Begleitet wurde dies mit einem rasanten Kitaausbau. Doch die Nachfrage wuchs schneller, sodass die Versorgungslücke 2024 für die unter Dreijährigen bei etwa 300.000 Plätzen lag. Da stellt sich die Frage, wie sich die Einrichtungen deutschlandweit und innerhalb der Städte verteilen. Und ob das Angebot genügend Familien in sozial benachteiligten Stadtteilen, die besonders darauf angewiesen sind, erreicht.
Aus dem Bericht des Beauftragten der Bundesregierung für Ostdeutschland 2023 geht hervor, dass Menschen in Städten im Vergleich zu jenen auf dem Land zufriedener sind mit den Angeboten der Daseinsvorsorge, sei es in puncto Einkaufsmöglichkeiten oder dem ÖPNV. Außer beim Kitaangebot: Da ist die ländliche Bevölkerung zufriedener. Außerdem gibt es eine sehr hohe und zunehmende sozioökonomische Segregation in Städten. Die räumliche Abgrenzung und Aufteilung verschiedener sozialer Gruppen innerhalb von Städten nimmt also zu, und zwar vor allem bei Kindern aus sozial schwachen Haushalten. Die PISA-Studien zeigen, dass sozioökonomische Hintergründe einen wachsenden Einfluss auf die Bildung von Kindern haben. Wenn Kitas vorhandene Nachteile nicht auffangen können, hat dies weitreichende Folgen für die Bildungsbiografie der Kinder.
Dieser Gemengelage hat sich unser Team aus Forscherinnen und Forschern des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) und des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung angenommen und die Verteilung von Kitas in Städten systematisch analysiert. Der Titel der Studie heißt, passend zu unserer Hypothese, „Kita-Versorgungsungleichheiten – eine Analyse auf Stadtteilebene“.
Die Kernergebnisse im Überblick
- 20 Prozent der Quartiere mit der niedrigsten SGB-II-Quote (geringer Anteil an Bürgergeldempfängerinnen und -empfängern innerhalb einer Stadt) sind um 15,7 Prozent besser mit Kitas versorgt als der jeweilige Stadtdurchschnitt.
- Die 20 Prozent der Quartiere mit der höchsten SGB-II-Quote (hoher Anteil an Bürgergeldempfängerinnen und -empfängern innerhalb einer Stadt) weisen hingegen 14,5 Prozent weniger Einrichtungen im Vergleich zum Stadtdurchschnitt auf.
- Der Unterschied zwischen den sozioökonomisch am besten und den am schlechtesten gestellten Quartieren beträgt über ein Drittel.
- Mitunter besteht eine doppelt, dreifach oder sogar vierfach so gute Versorgung eines sozioökonomisch gut gestellten Stadtteils verglichen mit einem prekären Stadtteil.
- Die Differenzierung nach Trägerschaften fördert dabei markante Unterschiede zutage: Die Ungleichheit in der Versorgung kommt daher zustande, dass sich freie gemeinnützige Träger (konfessionelle und sonstige) deutlich häufiger in prosperierenden Quartieren ansiedeln als in sozial schwachen.
- Für westdeutsche Städte zeigt sich, dass sich öffentliche Kitas sogar stärker in prekären Stadtteilen ansiedeln. Das mildert die Versorgungsungleichheiten an Einrichtungen zwar etwas ab, kann sie jedoch nicht kompensieren.
Warum Kommunen jetzt handeln müssen
Frühkindliche Bildung verbessert die Startchancen in der Schule – insbesondere für Kinder aus sozioökonomisch benachteiligten Haushalten. Wenn ausgerechnet diese Haushalte unterversorgt sind, verspielen wir enormes Potenzial. Ein Grund, weshalb die Kernaussage unserer Studie auch lautet: Dort, wo die Kitas am meisten nützen, sind sie am rarsten.
Es muss sich vieles ändern, und die Hebel dafür gibt es: Erstens muss sich die öffentliche Trägerschaft (noch) stärker auf prekäre Quartiere fokussieren. Zweitens sollten die Kommunen die Standortentscheidungen gemeinnütziger Träger besser steuern. Drittens wäre eine besondere Unterstützung von Elterninitiativen in sozial prekären Stadtteilen zu begrüßen. Der in einkommensstarken Stadtteilen vorherrschende Mangel an Kitaplätzen wird oft durch privates Elternengagement ausgeglichen. Indem Kommunen Eltern in einkommensschwächeren Quartieren unterstützen, etwa durch Beratung, könnten diese selbst entsprechende Initiativen gründen und so die Versorgungsungleichheit so gut es geht auffangen.

Dr. Melinda Fremerey ist persönliche Referentin des Direktors des Instituts der deutschen Wirtschaft und eine der Autorinnen der Studie „Kita-Versorgungsungleichheiten – eine Analyse auf Stadtteilebene“.
Zur Methodik
Die Autorinnen und Autoren Matthias Diermeier, Jan Engler und Melinda Fremerey vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) sowie Leon Wansleben vom Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung (MPIfG) haben Daten über Google von 66.355 Kitas deutschlandweit erhoben. Nach Aufbereitung der Daten wurden 17.099 Einrichtungen in 2.613 Quartieren in 52 deutschen Städten identifiziert. Erfasst wurden öffentliche, konfessionelle und sonstige gemeinnützige Träger. Kitas wurden anteilig dem Stadtteil zugeordnet, in dem sie liegen, oder dem Stadtteil, aus dem sie innerhalb von fünf Pkw-Minuten über die Stadtteilgrenze hinweg erreichbar sind. Als Kita-Versorgungsindikator wurde die Anzahl an erreichbaren Kitas pro Kind im Quartier im Verhältnis zum Stadtdurchschnitt berechnet. Für alle Ergebnisse wurden die Quartiere anhand der Anzahl dort gemeldeter Kinder gewichtet.